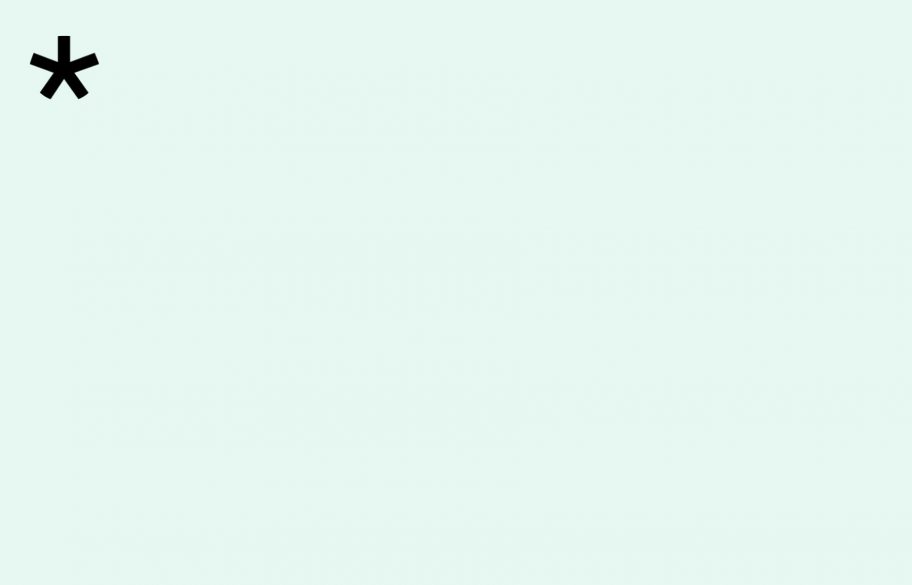Ich treffe Nandita Kumar in einem Park, denn obwohl Covid-19 offiziell vorüber ist, steigen die Fallzahlen. Der virale Kontext, der unser Treffen prägt und seinen Ort bestimmt, ist in diesem Fall nicht trivial, sondern berührt einen wesentlichen Teil von Kumars Arbeit. Sie dehnt die Vorstellung von Kunst nicht nur auf den Klang aus, sondern auf das Unsichtbare und das Dazwischen, von wo aus sie die komplexen Verflechtungen der Lebewesen und ihrer Umwelt beleuchtet – und die aktuellen Krisen, die diese Beziehung definieren. Begegnungen, Kooperationen und Gespräche prägen Kumars Arbeitsmethoden, durch die sie Kunstwerke wie auch Entdeckungsprozesse kreiert, die zu etwas führen, das ich „Informationsmodelle“ nennen möchte. Diese „Modelle“ erzeugen ein Portal zu komplexen wissenschaftlichen Datensätzen, die es uns ermöglichen, die miteinander verwobenen globalen Herausforderungen, mit denen wir heute konfrontiert sind, mit allen Sinnen zu erfassen, anstatt sie einfach nur zu verstehen.
Der Park als Bionetzwerk ist der passende Ort für ein Gespräch über Kumars jüngste Arbeiten. Eine davon, The Unwanted Ecology, ist „eine futuristische, sich selbst erhaltende Sound-Biosphäre mit als Unkraut klassifizierten Pflanzen“, die sie auf Reisfeldern im Umkreis von zwanzig Minuten um ihr Studio in Guirim, Nord-Goa, gesammelt hat, einem Brennpunkt der Biodiversität, wo sie seit 2015 lebt und arbeitet. Das Werk ist ein hypnotisierendes Diorama von Wildpflanzen, das mit Solarenergie betrieben und von Feuchtigkeitssensoren gesteuert wird. Optisch erinnert es an Vitrinen aus dem 19. Jahrhundert und deren botanisch-koloniale Ästhetik, führt uns aber in eine digitale Zukunft, in der die Besonderheiten und Heilkräfte von Unkraut in einer dekolonialen und wahrhaft globalen Sphäre gewürdigt werden. Der Soundtrack rückt die unbeliebten Kräuter in ein neues Licht, indem er sie mit ihren medizinischen Eigenschaften in Verbindung bringt. Zusammen mit Kari Rae Seekins, ihrer langjährigen Projektpartnerin von CalArts, bringt Kumar diese heilenden Frequenzen zum Erklingen. So entsteht eine Klangsphäre, die zugleich wissenschaftlich und fantasievoll ist: multisensorische „Science Fiction“, die über gemeinschaftliches und interdisziplinäres Arbeiten reflektiert und transformative Ideen aufzeigt, wie Wissenschaft, Alltag und Kunst sich verknüpfen lassen, um die Möglichkeiten, die in der Diversität von Wahrheiten steckt, neu zu denken.
Ein weiteres Werk ist Osmoscape, die grafische „Partitur einer Datenlandschaft“, die „verschiedene Aspekte von Wasser rund um die Themen Knappheit, Politik und gegenseitige Abhängigkeit“ erklingen lässt und damit auch darstellt. Die Arbeit umfasst eine skulpturale Installation, ein Buch, Street Art und eine App, die aus achtundvierzig Datensätzen besteht, die Wasser erforschen, um die komplexen politischen, sozialen und infrastrukturellen Wechselwirkungen verheerender „Wasserkriege“ zu demonstrieren. Die Partitur ist ebenso schön wie eindringlich und stellt Informationen, Imagination und Sinneseindrücke nebeneinander, um deutlich zu machen, was uns Wasser über Klima, Umweltverschmutzung und sein eigenes Verschwinden sagen kann – ein großartiges Beispiel für Kumars genreübergreifenden, interdisziplinären Prozess, der Gespräche und Untersuchungen über Disziplinen und kulturelle Grenzen hinweg ausdehnt, um eine andere Vorstellung von dem, was im Dazwischen liegt, zu schaffen.
Text: Salomé Voegelin
Übersetzung: Anna Jäger